Fotografie und Konflikt

Ab wann ist jemand ein Kriegsfotograf? Und ist es leichtfertig, für die Beeinflussung durch Bilder den Begriff „Bilderkrieg“ zu verwenden? Zählt eine Enthauptung mehr als ein Tod durch Bomben, und darf man die Opfer fotografieren und in die Medien bringen?
Felix Koltermann, der Fotodesign und Friedens- und Sicherheitsstudien studiert hat, diskutiert in seinem aktuellen Buch „Fotografie und Konflikt - Interviews und Gespräche“ mit seinen Interviewpartnern über diese und andere Fragen. So spricht er mit dem durch sein Buch „War Porn“ bekannten deutschen Fotografen Christoph Bangert über Zensur und Selbstzensur. Den amerikanischen Kunsthistoriker W.J.T. Mitchell befragt er u.a. zum Eigenleben von Bildern im digitalen Zeitalter.
Außerdem sind in dem Buch der Schweizer Fotograf Meinrad Schade vertreten, der zuletzt vor allem im postsowjetischen Raum zu eingefrorenen Konflikten recherchiert hat, der amerikanische Fotojournalist Michael Kamber, der deutsche Kunsthistoriker Tom Holert, der österreichische Fotograf Gregor Sailer und der Berliner Fotograf Kai Wiedenhöfer. Letzterer war gerade mit der Ausstellung „War on Wall“ über den Krieg in Syrien in Berlin präsent und im vergangenen Jahr Referent auf der n-ost-Medienkonferenz.
Wir veröffentlichen aus dem Interview mit Kai Wiedenhöfer einen Auszug:
Felix Koltermann: Herr Wiedenhöfer, warum haben Sie sich entschieden, ein Projekt über Syrien zu machen?
Kai Wiedenhöfer: Ich habe von 1991 bis 1993 in Syrien Arabisch studiert. Seit dieser Zeit habe ich eine gute Kenntnis des Landes. Ich mag die Leute dort sehr. Für mich ist die Gesellschaft in Syrien die modernste Zivilgesellschaft, die man im Nahen Osten findet, noch stärker als die Palästinenser, bei denen ich sehr viel Zeit verbracht habe. Deswegen ist es für mich sehr bitter zu sehen, wie das jetzt alles in Stücke geschlagen wird und diese Errungenschaft verloren geht, der Prozess also quasi rückwärtsgeht.
Im Vordergrund Ihres Projekts stehen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien, die sie porträtieren. Wie kam es zu diesem besonderen Fokus?
Wiedenhöfer: Im Januar 2013 war ich für einen Monat in Aleppo. Das war noch bevor Daesh bzw. der Islamische Staat erschien. Schon damals war es sehr gefährlich, dort zu arbeiten. In der Zwischenzeit ist es noch viel schlimmer geworden und man kann in Syrien als westlicher Journalist eigentlich nicht mehr arbeiten. Deswegen habe ich mir überlegt, wie ich den Krieg visualisieren kann, ohne ins Land reisen zu müssen. Dazu kommt, dass in Syrien so viele Kameras präsent sind, dass man eine stringente Idee haben und visuell umsetzen muss, die eben nicht die fünfhundertste Visualisierung einer abgeschossenen Panzerfaust ist. Ich habe ein ähnliches Projekt bereits im Gazastreifen durchgeführt und habe das Konzept jetzt auf den Konflikt in Syrien angewendet. Der Unterschied war, dass die Leute aus Syrien Flüchtlinge sind. Das heißt, ich konnte sie nicht in ihren Häusern fotografieren.
Sie porträtieren in Ihrem Projekt Menschen mitkrassen körperlichen Verletzungen. Wie ist es möglich, diese Menschen würdevoll zu fotografieren?
Wiedenhöfer: Wichtig ist zu versuchen, die Verletzungen fotografisch so redundant zu machen oder so weit zurücktreten zu lassen, wie es möglich ist. Und manche Leute habe ich nicht fotografiert, weil sie einfach furchtbar aussehen. Da helfen auch fotografische Hilfsmittel nicht mehr. Das ist einfach nur noch purer Horror.
Im Nachwort zu ihrer Broschüre kritisieren Sie, dass Redaktionen westlicher Medien aus „ethischen Gründen" oft keine Bilder von Opfern zeigen. Was genau stört Sie am Umgang der Medien mit Kriegsbildern?
Wiedenhöfer: Man muss sich einfach überlegen, was eine angemessene Visualisierung von Krieg sein kann. Krieg ist kein Kricketspiel und kein Abenteuer. Und wir sind sehr stark von den Bildern der Filmindustrie vorbelastet. Oft werden visuelle Hollywoodplots reproduziert und es finden sich immer wieder Anleihen an Piraten- und Kriegsfilme. Im Vordergrund stehen der Rauchpilz und die Aktion. Aber das sagt uns im Prinzip nichts über die Wirkung moderner Waffen. In Bezug auf Syrien sehe ich das Problem auch in der Obsession mit dem islamischen Staat. Der ist aber nur ein Teil des syrischen Krieges. Medien lassen sich sehr einfach instrumentalisieren, wenn man ihre Funktionsweise verstanden hat. Jeden Tag sterben in Syrien mehr Menschen als beim Germanwings Flugzeugabsturz, wo die Welt sich dann drei Wochen nur noch um dieses Thema dreht. So ein Ereignis ist natürlich schlimm für die Angehörigen, aber letztlich ist es das das Gleiche: Leute sterben jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag ...
Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie heute nicht mehr nach Syrien, insbesondere Aleppo gehen würden, wo Sie zuletzt 2014 waren. Trotzdem gehen ja immer noch ausländische Fotografen und Journalisten nach Syrien, vor allem viele Berufsanfänger. Wie stehen Sie dazu?
Wiedenhöfer: Ich weiß nicht, ob heute tatsächlich noch viele Leute nach Syrien reingehen. Ich glaube, so langsam hat es sich rumgesprochen, wie gefährlich es ist. Bei meiner letzten Syrienreise war ich in Kobanê, aber das war total sicher. Man muss eben Plätze finden, wo man arbeiten kann. Ansonsten ist das Risiko, das man auf sich nimmt, es einfach nicht wert. Und selbst wenn man vor Ort ist, ist man so reglementiert in dem was man machen und nicht machen kann, dass es kaum Sinn macht. Selbst wenn man ein Schreiber ist hat man da ein Problem. Und mit der Kamera kann man es vermutlich ganz vergessen, weil man zu stark auffällt.
Ich habe das Gefühl, dass dies zur Folge hat, dass zuletzt nur noch Frontberichterstattung in der Region entstanden ist. Leider erzählt die ja nicht sonderlich viel.
Wiedenhöfer: Das sehe ich nicht so. Wenn man einen guten Zugang hat, kann das sehr viel erzählen. Da habe ich dann nix dagegen, dass jemand mit einer Rebellengruppe zusammen ist. Wenn er ein bisschen Abstand zur Sache hat und das richtig schildern kann, passt das. Das Problem ist, dass man um in den Kampfgebieten in Syrien unterwegs zu sein, eine extreme Erfahrung braucht. Und die haben viele nicht. Wenn man kein voll militärisches Training hat, bleibt man am besten gleich zu Hause.
Also zählt für Einsätze in Krisenregionen vor allem ein militärisches Training?
Wiedenhöfer: Ja, auf jeden Fall. Und da rede ich nicht von einem einfachen Mehrtageskurs. Man muss wissen, was Feldartillerie ist, man muss wissen, was ein Panzer macht. Denn die Leute, mit denen man unterwegs ist, haben ja selbst keine Ahnung. Das sind Taxifahrer, Teppichfärber oder Studenten. Die können Dich nicht schützen, das muss man selbst übernehmen. Dazu kommt, dass die Verletzungsrisiken immens sind. Und wenn man dort verletzt wird, muss man sich einfach selber helfen können, sofern man das überhaupt noch kann. Aber das war ja auch in Libyen der Fall, z.B. mit Tim Hetherington. Der hatte eigentlich eine lächerliche Verletzung. Jeder Gefechtsfeldsanitäter hätte das in einem Halbminutenjob hinbekommen. Aber ihn hat es eben das Leben gekostet. Ich denke, diese Risiken einzugehen, für das bisschen mehr an Informationen, macht keinen Sinn und steht in keinem Verhältnis.
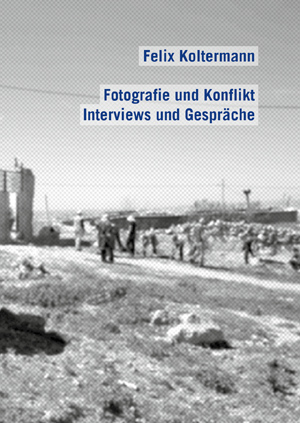
Links:
zur Buchbestellung „Fotografie und Konflikt“
Gleichnamiger Blog von Felix Koltermann

